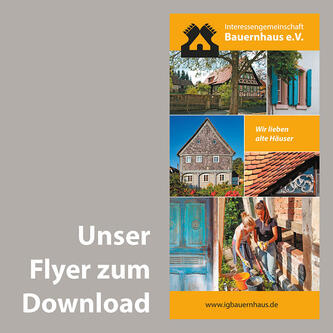Eckes
Hus – ein langjähriges IgB-Projekt
Das älteste Bauernhaus des Landkreises Rotenburg (Wümme) steht in Ostereistedt
Eckes Hus ist das älteste Bauernhaus des Landkreises Rotenburg (Wümme) und seit fast drei Jahrzehnten ein Projekt der dortigen IgB-Außenstelle.
Nachdem 1994 das Dach des Hauses einstürzte und in der Folge ein Abrissantrag gestellt werden sollte, hatten sich Mitglieder unserer Außenstelle zu einer Rettungssanierung entschlossen, die den Erhalt und die denkmalgerechte Präsentation des Hauses zum alleinigen Ziel hatte. Zunächst sammelten sie Geld und Spenden (auch das eigene Portemonnaie wurde nicht geschont) und schritten dann zur Tat. Zug um Zug wurde das Haus standsicher gemacht sowie Dach und Wände geschlossen, das Notwendigste am Haus also restauriert. Vorausgehend wurde das Haus noch von den IgB-Mitgliedern eingehend untersucht und dokumentiert. Es gab innerhalb der Gruppe nie die Absicht, sich eine wirtschaftliche Nutzung auszudenken, die Philosophie war immer, das Haus um seiner selbst willen zu erhalten. Eine ungewöhnliche Idee – zumal die IgB bis heute nur Besitzerin mit uneingeschränktem Nutzungsrecht aber nicht Eigentümerin des Gebäudes ist.



Entdeckt wurde das Haus im Jahr 1976 von Ulrich Klages, damals war es noch bewohnt. Die Nutzung war schon wahrhaft anachronistisch: ein alter Mann bewohnte drei Zimmer in dem riesigen Bauernhaus. Er heizte mit Öfen, die ihren Rauch in die offene Diele abgaben. Zentralheizung oder einen Schornstein gab es nicht, auf der Diele hingen die Schinken im Rauch. Es gab immerhin Strom, fließendes Wasser vom Nachbarhaus und eine Toilette, die in die Güllegrube des Hofes entleerte.
Wir haben das Haus aufgemessen, gezeichnet und dendrochronologisch
datiert. Noch stand Eckes Hus, von dem wir inzwischen wussten, dass es das
älteste so komplett erhaltenen und so altertümlich genutzte des Landkreises
war, nicht unter Denkmalschutz – leicht ironisch war unsere These: Es ist
einfach zu alt, um ein Baudenkmal zu werden. Dann stürzte 1994 der Dachstuhl
über dem Vorderhaus ein, der letzte Bewohner musste ins Altenheim umziehen und
die Gemeinde hielt einen Abrissantrag für unumgänglich. Nachdem wir unsere
Rettungsgruppe beisammen hatten, haben wir ein Konzept vorgestellt und Gelder
gesammelt. Wir konnten 1995 die Unterschutzstellung erlangen und 1996 mit den
Arbeiten beginnen.
Die Zahl der Arbeiten ist ebenso groß wie die der Helfer und der Förderinstanzen. Der Werdegang der Restaurierung wurde an verschiedenen Stellen im „Holznagel“, in einem Sonderband der Holznagel-Schriftenreihe, in der „Denkmalpflege in Niedersachsen“ und anderen Publikationen vorgestellt. Den schwersten Unfall der Bauzeit erlitt unser Elektroinstallateurs-Altmeister, der ehrenamtlich das Einziehen von neuen Leitern in alte Überputzleitungen besorgte, mit der Leiter stürzte und sich mehrere Rippen brach. Gefährliche Arbeiten – beim Bergen der eingestürzten Sparren, beim Beseitigen durchnässter Heu- und Strohberge auf den maroden Brettern des Dachbodens, beim Auswechseln der Schwellen unter den Innenständern und beim Ertüchtigen und Richten des gewaltigen Innengefüges – gingen ohne Unfall ab. Viele der Arbeiten haben wir an zahlreichen Bausonnabenden über die Jahrzehnte ehrenamtlich erledigen können.
Unser Konzept, ein unter heutigen Bedingungen unbewohnbares Haus mit allen Merkmalen des offenen Feuers im Flett, mit altertümlichen Fünf-Platten-Öfen im Kammerfach, mit Butzen und den Nutzungsspuren aus 450 Jahren zu präsentieren, haben wir in die Tat umgesetzt. Das Haus ist ein Museum seiner selbst, ein Baudenkmal, das vergleichbar anderen Denkmälern nur der Anschauung und Rückbesinnung, aber keinem wirtschaftlichen Zweck dient. Es steht zu Führungen und Besichtigungen offen, die mit Wolfgang Dörfler (04286 1456) und Hans-Hermann Bohling (04285 1534) verabredet werden können.
Wolfgang Dörfler, IgB
Update:
Gemeinsam kann viel gelingen! Dank Vereins- und Nachbarschaftshilfe konnte im Jahr 2023 eine Sicherungsmaßnahme durchgeführt werden: Am Tag des offenen Denkmals im letzten Jahr hatten wir bemerkt, dass sich in einem der großen Deckenbalken ein tiefer Riss gebildet hatte. Dieser Balken war schon 1995, zu Beginn der Sanierung von Eckes Hus, ein Sorgenkind. Wir entschlossen uns jetzt zu einem Überzug, der im nicht genutzten Teil des Dachraumes vom schadhaften Balken zu den beiden daneben liegenden Gebinden zieht und an dem wir den geschwächten Balken aufhängen konnten. Dank vieler helfender Hände konnte das Vorhaben gelingen und das älteste Bauernhaus des Landkreises Rotenburg (Wümme) für die Zukunft fit gemacht werden. Mehr dazu steht im Holznagel 5-2023. Hier geht es zum Artikel.