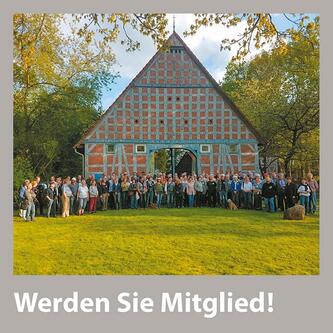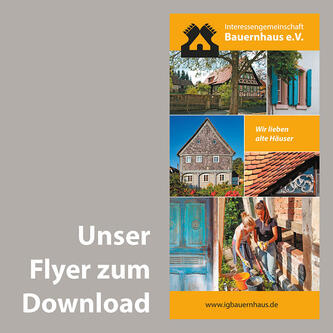Das erste von der Interessengemeinschaft Bauernhaus gekürte „Bauernhaus des Jahres“ war das Spreewaldhaus, was eine großartige Anerkennung für die besondere Spreewälder Blockbebauung bedeutet, jedoch auch eine immense Herausforderung an die Region zur Erhaltung dieses bäuerlichen Kulturerbes.
Die Beschreibung eines Blockhauses von Eberhard Deutschmann aus dem Buch „Lausitzer Holzbaukunst“
„Ein Blockhaus stellt eine fest zusammengefügte
Kiste dar, die als geschlossenes Ganzes keinen anderen Formenänderungen
als Schwundbewegungen unterliegt. Diese starre, geschrotene Kiste wird
dann an einigen Punkten auf Findlinge gelagert, damit zwischen
Grundschwelle und Erdreich eine Lücke verbleibt, die das Abfaulen der
Schwelle verhindert. Wenn sich die Findlinge mit der Zeit einsenken,
wird die ganze Blockhauskiste gehoben und mit neuen Steinen
unterfüttert. Diese punktartige Lagerung der hochliegenden Grundschwelle
hatte nicht nur Schutz gegen die aufsteigende Bodenfeuchtigkeit zu
bieten, sondern bewährte sich auch bei den alljährlichen
Überschwemmungen.“ Mit dieser Beschreibung charakterisierte Eberhard
Deutschmann in seinem 1959 veröffentlichten Buch „Lausitzer
Holzbaukunst“ wesentliche Merkmale der bäuerlicher Baukultur im
Feuchtgebiet des Spreewaldes.
Die Materialien für das traditionelle Bauernhaus des Spreewaldes kamen aus der Region
Das traditionelle Bauernhaus des Spreewaldes ist ein einfaches Blockhaus, das über die Jahre an die Besonderheiten der Spreewaldlandschaft und die Bedürfnisse ihrer Bewohner angepasst wurde. So entstanden verschiedene, regionaltypische Ausführungen dieser Häuser, die aus ineinandergesteckten Holzbohlen und einem mit Reet gedeckten Dach bestehen. Die Baumaterialien, Erle, Eiche und Rohr (Rogosch), stammten aus der von Wasser und Wald geprägten Region.
Der Oberspreewald liegt in einer eiszeitlich
geformten Niederung, die durch ihre flache Landschaft mit einem geringen
Gefälle das Flusswasser der Spree weitläufig verzweigen lässt und so
eine Auen- und Moorlandschaft bildet. Siedeln war in diesem feuchten
Gebiet nur dort möglich, wo Erhöhungen einen trockenen Untergrund
gewährten. So entstand am östlichen Rand des großen Flußdeltas auf einer
sandigen Anhöhe das Dorf Burg oder Borgk, dessen Name vom dortigen
Kiefernstandort abgeleitet wurde („Borkowy“, die Ansiedlung am
Kieferngehölz). Schon im Mittelalter hatten sich Wenden/Sorben dort
angesiedelt. Das Dorf Burg gehört zum Landkreis Spree-Neiße.
Gegen
Ende des 17. Jahrhunderts begannen die Bewohner außerhalb der
mittelalterlichen Dorfstruktur zu siedeln. Sie suchten in der Region
nahe des Dorfes, welches jedoch von Moor und Fließen des Binnendeltas
der Spree umgeben war, neuen Lebensraum. Auf den durch Schwemmsand
entstandenen leichten Erhebungen zwischen den Fließen, den sogenannten
Kaupen, begannen sie ihre Grundstücke urbar zu machen und dort
Blockhäuser zu errichten. So entstand zu jener Zeit eine
„Schwarzbausiedlung“ in den Kaupen. Die Höfe konnten damals nur über den
Wasserweg erreicht werden.
Legalisierung der Kaupensiedlung und Urbarmachung von Niedermoorbereichen
1725 wurden per Rescript von König Friedrich Wilherm
I. die bestehenden Grundstücke auf den Kaupen legalisiert und eine
gezielte Kolonisierung der Region angestrebt, die sogenannte Innere
Kolonisation zur Ansiedlung „ausländischer Familien“. So erweiterte sich
der einstige Dorfkern Burg im Bereich der Kaupen zu einer großen
Streusiedlung. Auch im Niedermoorbereich entstand ab 1766 unter König
Friedrich II. durch gezielte Entwässerung und Urbarmachung neuer
Siedlungsraum - der heutige Ortsteil Burg-Kolonie.
Bei der
Besiedlung der Kaupenlandschaft errichteten Menschen unterschiedlicher
Besitzstände und Rangordnungen wie Bauern, Halbbauern, Kossäten, Büdner
und Handwerker ihre Häuser ausschließlich in Blockbauweise.